|
Startseite
|
 Zurück
Vor
Zurück
Vor

|
|
|
|
|
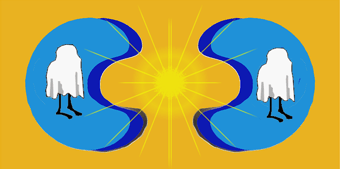 |
Die Tragödie (oder das Trauerspiel)
gilt als die höchste Form des Dramas. Sie ist eng verbunden
mit dem Begriff des Tragischen. Gegenstand
der Dichtung ist die Tragik, die entsteht, wenn der Mensch
in einen unlösbaren Konflikt zwischen zwei Mächten verwickelt
wird, in dem er sich für eine entscheiden muss, obwohl er
beiden zuneigt, beide für wertvoll hält. Es kann sich um
die Kollision von zwei weltlichen Mächten (Konflikt der
Pflichten) oder einer weltlichen und einer überweltlichen
(Gott-Mensch-Konflikt) handeln, es können zwei gleichberechtigte
ethische Normen zusammenprallen (Konflikt zwischen Notwendigkeit
und Freiheit); der Held kämpft für eine Seite, wird zwangsläufig
schuldig, weil die andere Seite ebensolches Lebensrecht
hat, von ihm aber bedroht oder geschädigt wird. Am Ende
unterliegt der Held; er muss nicht sterben, er kann auch
seelisch zusammenbrechen. Auf den tragischen Untergang hin
ist die Tragödie aufgebaut, der Verlauf ist unaufhaltsam
und notwendig.
|
|
|
Seit Aristoteles
fragt man nach den Regeln der Tragödie, und seither wandeln
sich die Antworten. Die konzentrierteste Formulierung des
klassischen Begriffs von tragisch stammt von Goethe: »Das
Tragische beruht auf einem unausgleichbaren Gegensatz.«
Je tiefer das Leid
des Helden, um so größer die Wirkung der Tragödie, deren
Ziel die Erschütterung des Zuschauers ist. Diese ergibt
sich aus dem Bezug zu unserer Welt: Auch wir könnten in
einer gleichen Situation so handeln, auch wir sind bedroht.
Doch wer ist der Zuschauer bei der Tragödie
der Menschen? Es kann einen Wendepunkt für den Helden geben,
in dem er seine Krise begreift und diese als solche annimmt.
|
|
|
|
|
|

